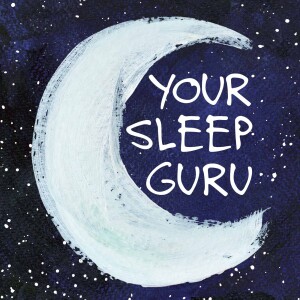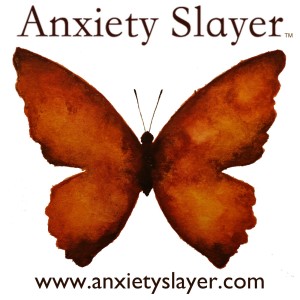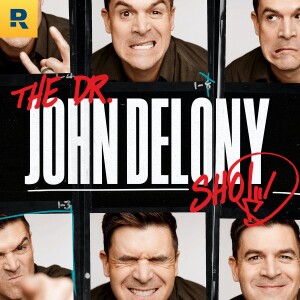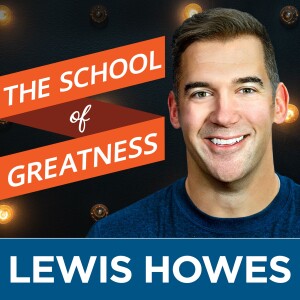Psychologie-Special: Verhalten von Menschen richtig einschätzen (Attributionstheorien).
Oft entstehen falsche Eindrücke von Personen, weil ihnen z. B. unterstellt wird, etwas bewusst zu tun, wobei sie gar keine Kontrolle darüber haben (bspw. weil sie psychisch krank sind). Unter anderem darum geht es in dieser Folge.
Diese Psychologie-Special Folge vertieft das Thema Attributionen, welches in der vorherigen Folge (#5 - Attributionen: Darum sind wir alle Hobbypsycholog:Innen) aufgegriffen wurde. Die Folge ist interessant für alle, die in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst wenig Aufwand verstehen möchten, inwiefern wir im Alltag über andere Menschen ein Urteil fällen. Meistens fehlen uns viele Informationen, weshalb wir uns etwas zusammenreimen, das nicht der Realität entspricht. Durch das Wissen über die verschiedenen Attributionstheorien, können wir unsere Fehleinschätzungen reflektieren und ihnen vorbeugen. Desweiteren können wir verstehen, weshalb wir selbst von anderen oft missverstanden werden. Es werden daher die vier wichtigsten Attributionstheorien vorgestellt, welche gleichzeitig heruntergebrochen, mit Alltagsbeispielen verziert und „entkompliziert“ werden.
Attributionen sind als Ursachenzuschreibungen oder soziale Erklärungen zu verstehen. In der Attributionsforschung wird untersucht, inwiefern Menschen beim Beobachten anderer Personen zu Schlussfolgerungen über deren Verhaltensursachen, Motive und Intentionen kommen. Es wird demnach die beobachtende Person betrachtet, welche das Verhalten eines Handelnden für sich erklärt und ihm Ursachen zuschreibt. Attributionstheorien beschäftigen sich also damit, wie Menschen auf die Ursachen des Verhaltens anderer schließen.
Die naive Handlungsanalyse (Heider, 1958)
Fritz Heider, der Begründer der Attributionstheorie, unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Arten von Attributionen: der internalen und der externalen. Wir können die Ursache beobachteter Handlungen entweder der Person selbst (internal) oder den äußeren Umständen (external) zuschreiben.
Theorie der korrespondierenden Schlussfolgerungen (Jones & Davis, 1965)
Nach der Theorie der korrespondierenden Schlussfolgerungen geht die beobachtende Person davon aus, dass der Handelnde verschiedene Handlungsoptionen hat und sich für eine davon entscheidet. Die Entscheidung der handelnden Person zwischen verschiedenen Handlungsalternativen wird in der Attribution des Beobachters berücksichtigt. Die Ursachenzuschreibung geschieht also beim Abgleich der ausgeführten Handlung (+ Konsequenzen) mit den nicht-ausgeführten, alternativen Handlungoptionen (+ Konsequenzen).
Das Kovariationsprinzip (Kelley, 1973)
Bei dem Kovariationsprinzip wird zwischen drei verschiedenen Arten von Attributionen unterschieden.
- Personenattributionen: Ursachen liegen in der handelnden Person.
- Stimulusattributionen: Ursachen liegen in Eigenschaften eines Stimulus bzw. der Umgebung.
- Umständeattributionen: Ursachen liegen in spezifischen Umständen zu bestimmten Zeitpunkten.
Menschen nutzen zudem drei verschiedene Quellen, aus denen sie ihre Informationen beziehen: Konsistenz, Konsens und Distinktheit.
- Konsistenz: Informationen über Unterschiede zwischen Situationen. Wie häufig führt die handelnde Person das spezifische Verhalten gegenüber demselben Stimulus unter denselben Umständen aus?
- Konsens: Informationen über Unterschiede zwischen Personen. Wie verhalten sich andere Menschen gegenüber dem gleichen oder einem ähnlichen Stimuli?
- Distinktheit: Informationen über Unterschiede zwischen Stimuli. Wie verhält sich die handelnde Person in unterschiedlichen, anderen Situationen?
Die Umständeattribution beschreibt eine Ausnahme und findet deshalb vor allem bei niedriger Konsistenz statt. Dabei sind Konsens zumeist niedrig und Distinktheit hoch ausgeprägt. Eine Personenattribution findet insbesondere bei niedrigem Konsens, niedriger Distinktheit und hoher Konsistenz statt. Eine Stimulusattribution zeigt sich meist dann, wenn sowohl hoher Konsens als auch hohe Distinktheit und hohe Konsistenz vorliegen.
Ursachenschema (Weiner, 1986)
Bernard Weiner geht ebenfalls von externalen und internalen Attributionen aus, welche er als Lokationsdimension beschreibt. Zudem ergänzt er Heiders Annahmen um die Dimensionen Stabilität (stabil vs. variabel) und Kontrollierbarkeit (kontrollierbar vs. unkontrollierbar). Die Stabilität beschreibt die Veränderbarkeit der Ursache und die Kontrollierbarkeit den Einfluss der handelnden Person.
Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley
Jones, E. E. & Davis, K. E. (1965). From acts to dispositions: The attribution process in person perception. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Bd. 2, pp. 219-266). New York: Academic Press.
Kelley, H. H. (1973). The processes of causal attribution. American Psychologist, 28(2), 107–128.
Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer.
More Episodes
All Episodes>>You may also like
Create Your Podcast In Minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast