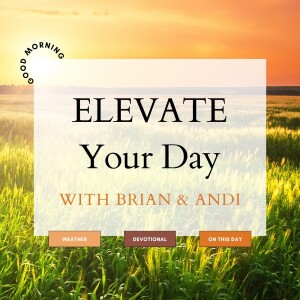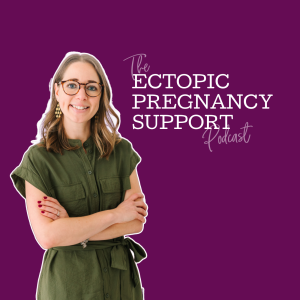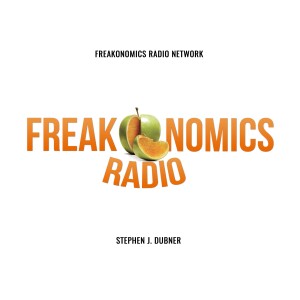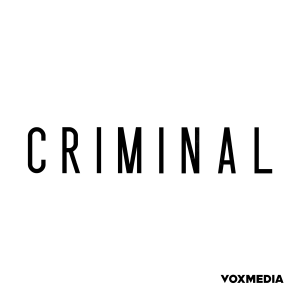Jüdische Geschichte Kompakt
https://juedischegeschichtekompakt.podigee.io/feed/mp3Episode List

#81 Jüdische Geschichte kompakt – Staffel 16.1: Umwegdiplomatie. Studentische Anfänge deutsch-israelischer Beziehungen
Hallo und herzlich willkommen bei Jüdische Geschichte Kompakt, in dieser Episode erläutert Dr. Jonas Hahn im Gespräch mit Miriam Rürup die ersten Begegnungen und Annäherungen zwischen Deutschen und Israelis über die deutsch-israelischen Studiengruppen, die an verschiedenen westdeutschen Universitäten entstanden und verschiedentlich Reisen nach Israel unternahmen sowie an den Hochschulstandorten in Deutschland eine intensive Debattenkultur zum deutschen Verhältnis zu Israel und Palästina entwickelten. Wir diskutieren hier unter anderem, ob gerade diese studentischen und zivilgesellschaftlichen Schritte der Annäherungen in einer Form von Umwegdiplomatie die Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1965 überhaupt erst ermöglichten. Dr. Jonas Hahn schloss im Jahre 2024 sein Promotionsstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) mit einer Dissertation zu den Anfängen der Studierenden- und Universitätsbeziehungen zwischen Deutschland und Israel während der 1950er- und 1960er-Jahren ab, die von Michael Brenner betreut wurde. Zuvor studierte Dr. Jonas Hahn Jüdische Studien und Islamwissenschaften in Heidelberg, Amman und Beer Sheva. Seit 2014 ist als Referent für Jugendaustausch bei ConAct tätig. Der Podcast Kanal Jüdische Geschichte Kompakt ist ein Gemeinschaftsprojekt des IGdJ in Hamburg und des MMZ in Potsdam. **Bleiben Sie gesund und interessiert, wir hören uns! Ihr Team des Podcast Jüdische Geschichte Kompakt**

#80 Jüdische Geschichte kompakt – Staffel 16: Deutsch-israelische Beziehungsgeschichte
Hallo und herzlich willkommen bei Jüdische Geschichte Kompakt, in diesem Intro zur 16. Staffel zum Thema " Deutsch-israelische Beziehungsgeschichten. Zivilgesellschaftliche Perspektiven auf 60 Jahre diplomatische Beziehungen" führt Miriam Rürup auf Nachfrage von Björn Siegel in die Ideen und Themenschwerpunkte dieser Staffel ein. Diese Staffel wird von Anna-Dorothea Ludewig und Miriam Rürup kuratiert und betrachtet die Geschichte der Beziehungen zwischen dem Staat Israel und der Bundesrepublik aus vier verschiedenen Perspektiven jenseits der politischen und zwischenstaatlichen Diplomatiegeschichte. Die gesamte Staffel betrachtet die (west)deutsch-israelischen Beziehungen aus einer vorstaatlichen Perspektive. **Die ersten Gespräche sind weit vor den aktuellen Entwicklungen aufgenommen worden.** **Inhalt der 16. Staffel:** Diese Staffel wird von Anna-Dorothea Ludewig und Miriam Rürup kuratiert und betrachtet die Geschichte der Beziehungen zwischen dem Staat Israel und der Bundesrepublik aus vier verschiedenen Perspektiven jenseits der politischen und zwischenstaatlichen Diplomatiegeschichte. So liegt es nahe, in der Staffel besonders die Jahre vor der eigentlichen Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu betrachten, die sich in diesem Jahr zum 60. Mal jähren. Bewusst haben wir uns für einen historischen Blick auf die Vorgeschichte des heutigen Verhältnisses zwischen der Bundesrepublik und Israel entschieden. In die Ideen und Themenschwerpunkte dieser Staffel führt Miriam Rürup im Intro dieses Projektes ein. Im ersten, ebenfalls heute online gehenden Teil, erläutert Dr. Jonas Hahn im Gespräch mit Miriam Rürup die ersten Begegnungen und Annäherungen zwischen Deutschen und Israelis über die deutsch-israelischen Studiengruppen, die an verschiedenen westdeutschen Universitäten entstanden und verschiedentlich Reisen nach Israel unternahmen sowie an den Hochschulstandorten in Deutschland eine intensive Debattenkultur zum deutschen Verhältnis zu Israel und Palästina entwickelten. In einer weiteren Folge sprechen Anna-Dorothea Ludewig und Ines Sonder (beide MMZ) mit Micha Grossmann, dem Leiter des Bauhaus-Center in Tel Aviv, und mit Ron Segal, in Berlin lebender Autor und Filmemacher, über den Kulturaustausch zwischen beiden Ländern sowie die zahlreichen Projekte und Initiativen kultureller Annäherungen zwischen beiden Gesellschaften. Aus den deutschen Beziehungen zu Israel ist die religiöse Grundierung nicht wegzudenken. Im Gespräch mit Katharina Troppenz, Vikarin in Tegel-Borsigwalde, die unter anderem über die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste geforscht hat, wird es um die zentrale Bedeutung christlicher Perspektiven auf das „Heilige Land“ gehen, die Israel für viele Deutsche besonders machen. Ein weiterer Aspekt der Staffel wird der Blick auf zivilgesellschaftliche Aktivitäten in Israel sein. In dieser in Kooperation mit dem New Israel Fund Deutschland produzierten Folge spricht Amir Theilhaber (MMZ) mit Lukas Welz (Amcha), Maja Sojref (Geschäftsführung NIF Deutschland) und Jutta Weduwen (ASF). Sie fragen, wie die Beziehungen der israelischen und deutschen Zivilgesellschaften heute aussehen und welche Bedeutung darin die historischen Entwicklungen der letzten 60 Jahre spielen. Die gesamte Staffel betrachtet die (west)deutsch-israelischen Beziehungen also aus einer vorstaatlichen Perspektive und bereits in der ersten Folge diskutieren wir, ob gerade die zivilgesellschaftlichen Schritte der Annäherungen in einer Form von Umwegdiplomatie die Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1965 überhaupt erst ermöglichten. Der Podcast Kanal Jüdische Geschichte Kompakt ist ein Gemeinschaftsprojekt des IGdJ in Hamburg und des MMZ in Potsdam. **Bleiben Sie gesund und interessiert, wir hören uns! Ihr Team des Podcast Jüdische Geschichte Kompakt**

#79.1: Lernpodcast - Der Weg zum Scheiterhaufen
Herzlich Willkommen zum Juli-Spezial von Jüdische Geschichte Kompakt Die Podcast-Trilogie „Wenn Bücher brennen“ ist ein Teil des am MMZ entwickelten Bildungsmaterials für Schüler:innen. Die Podcasts wurden von der Radiojournalistisch Stefanie Schuster im Auftrag erstellt. Gefördert wurde das Projekt durch den Landespräventionsrat Brandenburg. Die „Digitale Bibliothek verbrannter Bücher“ ist ein Projekt des Moses Mendelssohn Zentrums. Sie macht eine Auswahl von verfemten Büchern online zugänglich. Zusätzlich zu den Werken wird der historische Kontext sowie biografische Informationen zu den Autor:innen vorgestellt. Online: https://www.verbrannte-buecher.de. Lesetipp zum Juli-Spezial: Publikationen von Werner Treß, stellvertretender Direktor des MMZ zum Thema nationalsozialistische Bücherverbrennungen: Werner Treß (Hg.) (2009): Verbrannte Bücher 1933. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn. Julius H. Schoeps, Werner Treß (Hg.) (2008): Orte der Bücherverbrennung in Deutschland 1933. Hildesheim. Weitere Publikationen und Webseiten: Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus: Brandenburg `33. Erinnern vor Ort: Bücherverbrennung in Potsdam: https://brandenburg-33.de/bucherverbrennung-in-potsdam/. Bücherverbrennung in Brandenburg an der Havel: https://brandenburg-33.de/bucherverbrennung-in-brandenburg-an-der-havel/. Bücherverbrennung in Luckenwalde: https://brandenburg-33.de/bucherverbrennung-in-luckenwalde/. Burkhard Asmus, Oliver Schweinoch (2023): Bücherverbrennung. Lebendiges Museum Online: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung-der-ns-herrschaft/buecherverbrennung. Margrit Bircken, Helmut Peitsch (Hg.) (2003): Brennende Bücher. Erinnerungen an den 10. Mai 1933. Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Online: https://www.politische-bildung-brandenburg.de/system/files/publikation/pdf/brennende%20Buecher.pdf. Bundeszentrale für politische Bildung: Tag des Buches: https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/268884/tag-des-buches-erinnerung-an-die-ns-buecherverbrennungen-vor-85-jahren. Verbrannte Orte. Ein Onlineatlas zu den Orten der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen: https://verbrannte-orte.de. Anmerkungen und Literaturhinweise der Autorin der drei Podcasts, Stefanie Schuster: weitere Literaturhinweise: Digitale Bibliothek verbrannter Bücher des Moses-Mendelssohn-Zentrums Potsdam Jürgen Serke: Die verbrannten Dichter. Neue, erweiterte Auflage Göttingen 2023. Das ganze Interview mit Jürgen Serke gibt es in der Reihe: „Wenn Bücher brennen – Potsdam 1933“: Die Rückkehr der verbrannten Dichter - Teil 1 - Wenn Bücher brennen - Potsdam 1933 - Podcast Alexander Stephan: Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. München 1979. Wenn keine Originalaufnahmen der Autoren vorhanden waren, habe ich auf KI-Stimmen des Unternehmens Eleven Labs zurückgegriffen; besten Dank an dieser Stelle für diese Möglichkeit. Es wäre auch möglich gewesen, diese künstlichen Stimmen zu trainieren mit O-Tönen der betreffenden Autoren; darauf habe ich jedoch bewußt verzichtet, um nicht die Hörenden in die Irre zu führen. Doch die verwendeten Texte stammen aus der Feder der Autoren, wie auch im Manuskript und im gelesenen Stück kenntlich gemacht. Daher ist Thomas Mann mit zweierlei Stimmen vertreten im 3. Teil. Dabei handelt es sich bei dem ersten Stück um eine historische Rundfunkaufnahme – bei dem anderen um einen offenen Brief, der in den Zeitungen abgedruckt wurde und sich auch in seinen Gesammelten Werken findet. Die verwendeten Quellen für die drei Podcast-Folgen: Harald Jähner: Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen. Berlin 2022. Martin Sabrow (Hrsg): Gewalt gegen Weimar. Zerreißproben der frühen Republik 1918-1923. Göttingen 2023. Julius H. Schoeps / Werner Treß (Hrsg): Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933. Hilderheim, Zürich, New York 2008. Jürgen Serke: Die verbrannten Dichter. Neue, erweiterte Auflage Göttingen 2023. Alexander Stephan: Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. München 1979. Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland. Hamburg 1978. Volker Ullrich: Deutschland 1923. Das Jahr am Abgrund. München 2022. Ulrich Walberer (Hrsg.): 10. Mai 1933. Bücherverbrennung in Deutschland und die Folgen. Frankfurt 1983. Volker Weidermann: Das Buch der verbrannten Bücher. Köln 2008. Die Bücher, über die ich im Text rede, finden sich bereits teilweise in der Digitalen Bibliothek der verbrannten Bücher, die vom Moeses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam zur gemeinfreien Nutzung erstellt wird. Hier: Digitale Bibliothek verbrannter Bücher Eine kleine Hintergrundgeschichte zu ihrer Entstehung gibt es hier: Portal Transfer – Alumni- und Transfermagazin der Universität Potsdam – 2024: Seite 12 f unter dem Titel: Wiedergefunden und sicher aufbewahrt. Das Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien baut eine „Digitale Bibliothek der verbrannten Bücher“ auf. Das O-Ton-Material verdanke ich privaten Archiven. Die Nutzung der Podcastreihe und der damit zusammenhängenden Unterrichtsmaterialien ist im Rahmen der dafür vorgesehenen Verwendung kostenfrei, nachdem Sie sich beim Moses Mendelssohn Zentrum angemeldet haben. Das Urheberrecht verbleibt jedoch bei der Autorin, Stefanie Schuster, in all seinen Formen. Eine öffentliche, kostenpflichtige Verwendung oder eine andere, die auf Erzielung von Gewinnen ausgelegt ist, ist untersagt. Untersagt ist auch jegliche Veränderung der Episoden (Umschneiden / Umtexten). Die Ausspielung auf anderen als den dafür vorgesehenen Kanälen bedarf der Zustimmung des MMZ und der Autorin.

#79.3: Deutsche Literatur im Exil
Herzlich Willkommen zum Juli-Spezial von Jüdische Geschichte Kompakt Die Podcast-Trilogie „Wenn Bücher brennen“ ist ein Teil des am MMZ entwickelten Bildungsmaterials für Schüler:innen. Die Podcasts wurden von der Radiojournalistisch Stefanie Schuster im Auftrag erstellt. Gefördert wurde das Projekt durch den Landespräventionsrat Brandenburg. Die „Digitale Bibliothek verbrannter Bücher“ ist ein Projekt des Moses Mendelssohn Zentrums. Sie macht eine Auswahl von verfemten Büchern online zugänglich. Zusätzlich zu den Werken wird der historische Kontext sowie biografische Informationen zu den Autor:innen vorgestellt. Online: https://www.verbrannte-buecher.de. Lesetipp zum Juli-Spezial: Publikationen von Werner Treß, stellvertretender Direktor des MMZ zum Thema nationalsozialistische Bücherverbrennungen: Werner Treß (Hg.) (2009): Verbrannte Bücher 1933. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn. Julius H. Schoeps, Werner Treß (Hg.) (2008): Orte der Bücherverbrennung in Deutschland 1933. Hildesheim. Weitere Publikationen und Webseiten: Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus: Brandenburg `33. Erinnern vor Ort: Bücherverbrennung in Potsdam: https://brandenburg-33.de/bucherverbrennung-in-potsdam/. Bücherverbrennung in Brandenburg an der Havel: https://brandenburg-33.de/bucherverbrennung-in-brandenburg-an-der-havel/. Bücherverbrennung in Luckenwalde: https://brandenburg-33.de/bucherverbrennung-in-luckenwalde/. Burkhard Asmus, Oliver Schweinoch (2023): Bücherverbrennung. Lebendiges Museum Online: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung-der-ns-herrschaft/buecherverbrennung. Margrit Bircken, Helmut Peitsch (Hg.) (2003): Brennende Bücher. Erinnerungen an den 10. Mai 1933. Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Online: https://www.politische-bildung-brandenburg.de/system/files/publikation/pdf/brennende%20Buecher.pdf. Bundeszentrale für politische Bildung: Tag des Buches: https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/268884/tag-des-buches-erinnerung-an-die-ns-buecherverbrennungen-vor-85-jahren. Verbrannte Orte. Ein Onlineatlas zu den Orten der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen: https://verbrannte-orte.de. Anmerkungen und Literaturhinweise der Autorin der drei Podcasts, Stefanie Schuster: weitere Literaturhinweise: Digitale Bibliothek verbrannter Bücher des Moses-Mendelssohn-Zentrums Potsdam. Jürgen Serke: Die verbrannten Dichter. Neue, erweiterte Auflage Göttingen 2023. Das ganze Interview mit Jürgen Serke gibt es in der Reihe: „Wenn Bücher brennen – Potsdam 1933“: Die Rückkehr der verbrannten Dichter - Teil 1 - Wenn Bücher brennen - Potsdam 1933 - Podcast Alexander Stephan: Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. München 1979. Wenn keine Originalaufnahmen der Autoren vorhanden waren, habe ich auf KI-Stimmen des Unternehmens Eleven Labs zurückgegriffen; besten Dank an dieser Stelle für diese Möglichkeit. Es wäre auch möglich gewesen, diese künstlichen Stimmen zu trainieren mit O-Tönen der betreffenden Autoren; darauf habe ich jedoch bewußt verzichtet, um nicht die Hörenden in die Irre zu führen. Doch die verwendeten Texte stammen aus der Feder der Autoren, wie auch im Manuskript und im gelesenen Stück kenntlich gemacht. Daher ist Thomas Mann mit zweierlei Stimmen vertreten im 3. Teil. Dabei handelt es sich bei dem ersten Stück um eine historische Rundfunkaufnahme – bei dem anderen um einen offenen Brief, der in den Zeitungen abgedruckt wurde und sich auch in seinen Gesammelten Werken findet. Die verwendeten Quellen für die drei Podcast-Folgen: Harald Jähner: Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen. Berlin 2022. Martin Sabrow (Hrsg): Gewalt gegen Weimar. Zerreißproben der frühen Republik 1918-1923. Göttingen 2023. Julius H. Schoeps / Werner Treß (Hrsg): Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933. Hilderheim, Zürich, New York 2008. Jürgen Serke: Die verbrannten Dichter. Neue, erweiterte Auflage Göttingen 2023. Alexander Stephan: Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. München 1979. Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland. Hamburg 1978. Volker Ullrich: Deutschland 1923. Das Jahr am Abgrund. München 2022. Ulrich Walberer (Hrsg.): 10. Mai 1933. Bücherverbrennung in Deutschland und die Folgen. Frankfurt 1983. Volker Weidermann: Das Buch der verbrannten Bücher. Köln 2008. Die Bücher, über die ich im Text rede, finden sich bereits teilweise in der Digitalen Bibliothek der verbrannten Bücher, die vom Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam zur gemeinfreien Nutzung erstellt wird. Hier: Digitale Bibliothek verbrannter Bücher Eine kleine Hintergrundgeschichte zu ihrer Entstehung gibt es hier: Portal Transfer – Alumni- und Transfermagazin der Universität Potsdam – 2024: Seite 12 f unter dem Titel: Wiedergefunden und sicher aufbewahrt. Das Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien baut eine „Digitale Bibliothek der verbrannten Bücher“ auf. Das O-Ton-Material verdanke ich privaten Archiven. Die Nutzung der Podcastreihe und der damit zusammenhängenden Unterrichtsmaterialien ist im Rahmen der dafür vorgesehenen Verwendung kostenfrei, nachdem Sie sich beim Moses Mendelssohn Zentrum angemeldet haben. Das Urheberrecht verbleibt jedoch bei der Autorin, Stefanie Schuster, in all seinen Formen. Eine öffentliche, kostenpflichtige Verwendung oder eine andere, die auf Erzielung von Gewinnen ausgelegt ist, ist untersagt. Untersagt ist auch jegliche Veränderung der Episoden (Umschneiden / Umtexten). Die Ausspielung auf anderen als den dafür vorgesehenen Kanälen bedarf der Zustimmung des MMZ und der Autorin.

#79.2: Lernpodcast - Die Bücher brennen
Herzlich Willkommen zum Juli-Spezial von Jüdische Geschichte Kompakt Die Podcast-Trilogie „Wenn Bücher brennen“ ist ein Teil des am MMZ entwickelten Bildungsmaterials für Schüler:innen. Die Podcasts wurden von der Radiojournalistisch Stefanie Schuster im Auftrag erstellt. Gefördert wurde das Projekt durch den Landespräventionsrat Brandenburg. Die „Digitale Bibliothek verbrannter Bücher“ ist ein Projekt des Moses Mendelssohn Zentrums. Sie macht eine Auswahl von verfemten Büchern online zugänglich. Zusätzlich zu den Werken wird der historische Kontext sowie biografische Informationen zu den Autor:innen vorgestellt. Online: https://www.verbrannte-buecher.de. Lesetipp zum Juli-Spezial: Publikationen von Werner Treß, stellvertretender Direktor des MMZ zum Thema nationalsozialistische Bücherverbrennungen: Werner Treß (Hg.) (2009): Verbrannte Bücher 1933. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn. Julius H. Schoeps, Werner Treß (Hg.) (2008): Orte der Bücherverbrennung in Deutschland 1933. Hildesheim. Weitere Publikationen und Webseiten: Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus: Brandenburg `33. Erinnern vor Ort: Bücherverbrennung in Potsdam: https://brandenburg-33.de/bucherverbrennung-in-potsdam/. Bücherverbrennung in Brandenburg an der Havel: https://brandenburg-33.de/bucherverbrennung-in-brandenburg-an-der-havel/. Bücherverbrennung in Luckenwalde: https://brandenburg-33.de/bucherverbrennung-in-luckenwalde/. Burkhard Asmus, Oliver Schweinoch (2023): Bücherverbrennung. Lebendiges Museum Online: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung-der-ns-herrschaft/buecherverbrennung. Margrit Bircken, Helmut Peitsch (Hg.) (2003): Brennende Bücher. Erinnerungen an den 10. Mai 1933. Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Online: https://www.politische-bildung-brandenburg.de/system/files/publikation/pdf/brennende%20Buecher.pdf. Bundeszentrale für politische Bildung: Tag des Buches: https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/268884/tag-des-buches-erinnerung-an-die-ns-buecherverbrennungen-vor-85-jahren. Verbrannte Orte. Ein Onlineatlas zu den Orten der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen: https://verbrannte-orte.de. Anmerkungen und Literaturhinweise der Autorin der drei Podcasts, Stefanie Schuster: weitere Literaturhinweise: Digitale Bibliothek verbrannter Bücher des Moses-Mendelssohn-Zentrums Potsdam. Jürgen Serke: Die verbrannten Dichter. Neue, erweiterte Auflage Göttingen 2023. Das ganze Interview mit Jürgen Serke gibt es in der Reihe: „Wenn Bücher brennen – Potsdam 1933“: Die Rückkehr der verbrannten Dichter - Teil 1 - Wenn Bücher brennen - Potsdam 1933 - Podcast Alexander Stephan: Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. München 1979. Wenn keine Originalaufnahmen der Autoren vorhanden waren, habe ich auf KI-Stimmen des Unternehmens Eleven Labs zurückgegriffen; besten Dank an dieser Stelle für diese Möglichkeit. Es wäre auch möglich gewesen, diese künstlichen Stimmen zu trainieren mit O-Tönen der betreffenden Autoren; darauf habe ich jedoch bewußt verzichtet, um nicht die Hörenden in die Irre zu führen. Doch die verwendeten Texte stammen aus der Feder der Autoren, wie auch im Manuskript und im gelesenen Stück kenntlich gemacht. Daher ist Thomas Mann mit zweierlei Stimmen vertreten im 3. Teil. Dabei handelt es sich bei dem ersten Stück um eine historische Rundfunkaufnahme – bei dem anderen um einen offenen Brief, der in den Zeitungen abgedruckt wurde und sich auch in seinen Gesammelten Werken findet. Die verwendeten Quellen für die drei Podcast-Folgen: Harald Jähner: Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen. Berlin 2022. Martin Sabrow (Hrsg): Gewalt gegen Weimar. Zerreißproben der frühen Republik 1918-1923. Göttingen 2023. Julius H. Schoeps / Werner Treß (Hrsg): Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933. Hilderheim, Zürich, New York 2008. Jürgen Serke: Die verbrannten Dichter. Neue, erweiterte Auflage Göttingen 2023. Alexander Stephan: Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. München 1979. Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland. Hamburg 1978. Volker Ullrich: Deutschland 1923. Das Jahr am Abgrund. München 2022. Ulrich Walberer (Hrsg.): 10. Mai 1933. Bücherverbrennung in Deutschland und die Folgen. Frankfurt 1983. Volker Weidermann: Das Buch der verbrannten Bücher. Köln 2008. Die Bücher, über die ich im Text rede, finden sich bereits teilweise in der Digitalen Bibliothek der verbrannten Bücher, die vom Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam zur gemeinfreien Nutzung erstellt wird. Hier: Digitale Bibliothek verbrannter Bücher Eine kleine Hintergrundgeschichte zu ihrer Entstehung gibt es hier: Portal Transfer – Alumni- und Transfermagazin der Universität Potsdam – 2024: Seite 12 f unter dem Titel: Wiedergefunden und sicher aufbewahrt. Das Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien baut eine „Digitale Bibliothek der verbrannten Bücher“ auf. Das O-Ton-Material verdanke ich privaten Archiven. Die Nutzung der Podcastreihe und der damit zusammenhängenden Unterrichtsmaterialien ist im Rahmen der dafür vorgesehenen Verwendung kostenfrei, nachdem Sie sich beim Moses Mendelssohn Zentrum angemeldet haben. Das Urheberrecht verbleibt jedoch bei der Autorin, Stefanie Schuster, in all seinen Formen. Eine öffentliche, kostenpflichtige Verwendung oder eine andere, die auf Erzielung von Gewinnen ausgelegt ist, ist untersagt. Untersagt ist auch jegliche Veränderung der Episoden (Umschneiden / Umtexten). Die Ausspielung auf anderen als den dafür vorgesehenen Kanälen bedarf der Zustimmung des MMZ und der Autorin.
Create Your Podcast In Minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast