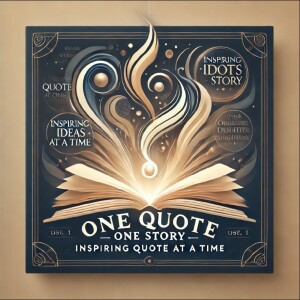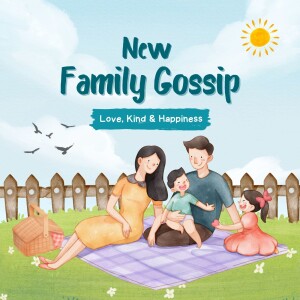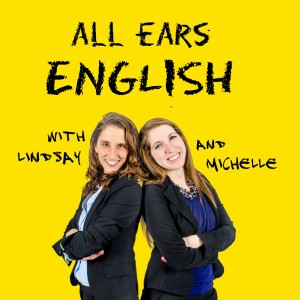Rechtsbelehrung - Recht, Technik & Gesellschaft
http://rechtsbelehrung.com/feed/podcastEpisode List

Zwangsentsperrung von Smartphones – Rechtsbelehrung 139
Einen Fingerabdruck auf den Sensor legen, um das Smartphone zu entsperren, ist bequem und einfach. Aber darf der Finger auch unter Zwang von Polizeibeamten geführt werden? Der Bundesgerichtshof hat diese Frage in einem Beschluss von diesem Jahr bejaht (BGH, 13.03.2025, Az. 2 StR 232/24). Eine altes Gesetz für moderne Technik Ermittlungsbehörden dürfen nach Ansicht des BGH Beschuldigte unter Zwang dazu bringen, ihr Smartphone mittels biometrischer Verfahren freizuschalten. Begründet wird dies mit einer erkennungsdienstlichen Vorschrift aus den 1960er Jahren, die nach Auffassung des Gerichts auch auf moderne biometrische Daten anwendbar ist (§ 81b StPO). Kritik an der Entscheidung Die Entscheidung ist hoch umstritten. Kritiker sehen darin eine verfassungswidrige Ausweitung des Strafprozessrechts. Eine Norm, die eigentlich nur die Feststellung körperlicher Merkmale erlaubt, wird plötzlich zur Universalermächtigungsgrundlage für tiefgreifende Eingriffe in das digitale Leben. Damit geraten der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit und das IT-Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität der Endgeräte massiv unter Druck. Diskussion mit Dr. Felix Ruppert Dr. jur. Felix Ruppert (LinkedIn) lehrt & forscht als Akademischer Rat a.Z. an der LMU München am Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und das Recht der Digitalisierung. Er ist Herausgeber der Zeitschrift für Cyberstrafrecht. Gemeinsam mit unserem Gast Dr. Felix Ruppert, der die Entscheidung bereits scharf kritisiert hat (StV-S, 8/2025, LTO, Deutschlandfunk Kultur), sprechen wir darüber, warum die Argumentation des BGH auf wackeligen Füßen steht. Außerdem geht es um die Rolle von Zufallsfunden, die Grenzen durch Verhältnismäßigkeit und Durchsuchungsbeschlüsse, die Frage, ob Ermittlungsbehörden mit dem Urteil einen Blankoscheck in den Händen halten, und warum die letzte Instanz wohl das Bundesverfassungsgericht sein könnte. Praktische Fragen Zum Schluss diskutieren wir auch die praktische Seite. Wie sollte man sich als Beschuldigter verhalten und sind biometrische Sicherungen wirklich die beste Wahl? Wir bedanken uns herzlich bei unserem Gast und wünschen wie immer viel Vergnügen beim Hören. Zeitmarken 00:00:00 – Einführung ins Thema und Vorstellung des Gastes 00:09:40 – „Freiwillige“ Entsperrung unter psychischem Druck – ist die Einwilligung wirksam? 00:15:00 – Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit 00:16:45 – Dreiklang: Freiwilliger Zugang, biometrische Entsperrung, technischer Zugriff ohne Mitwirkung des Besitzers 00:18:00 – Das Smartphone als zentraler Datenpunkt des modernen Menschen 00:24:00 – Zufallsfunde im Strafverfahren – dürfen sie verwertet werden? 00:27:00 – Technisches Aufbrechen, Durchsuchen von Endgeräten, Beschlagnahme von Daten & Kommunikationsüberwachung 00:33:30 – Erzwungene biometrische Entsperrung – darf man sich dagegen wehren? 00:37:30 – Welche Rechtsgrundlage gibt es für die Zwangsentsperrung? 00:45:00 – Technikoffenheit und kreative Rechtsauslegung: eine Blankovollmacht für Ermittlungsbehörden? 00:53:50 – Ein Fall für das Bundesverfassungsgericht? 00:56:40 – Durchsuchungsbeschluss & Verhältnismäßigkeit als Grenzen der Zwangsentsperrung 01:04:00 – Reaktionen auf das Urteil 01:08:00 – Verwertung rechtswidrig erlangter Beweise – und warum die konkrete Sachlage (Kindesmissbrauch) das Urteil beeinflusst haben könnte 01:16:00 – Zukunftsperspektiven: Welche Entwicklungen sind zu erwarten? 01:20:00 – Praktische Tipps: Wie sollte man sich verhalten? Der Beitrag Zwangsentsperrung von Smartphones – Rechtsbelehrung 139 erschien zuerst auf Rechtsbelehrung.

Bingo, Fun-Facts und heimliche Kameraaufnahmen – Obiter Dictum 16
In dieser Ausgabe unseres freien Formats stellt euch zuerst Dr. Schwenke in einer fast perfekten Influencermanier sein neu erscheinendes Buch „Recht für Online-Marketing und KI“ vor: „Recht für Online-Marketing und KI“ bietet praxisnahes Wissen zu allen wichtigen Rechtsfragen im digitalen Marketing – von der Content-Erstellung bis zum Einsatz Künstlicher Intelligenz im Unternehmen. Ideal zum Lernen und Nachschlagen. Von dem Buch könnt ihr drei Exemplare gewinnen! Nehmt am Gewinnspiel teil, indem ihr unter diesem Beitrag oder in den begleitenden Social-Media-Beiträgen das Kennwort „Buch“ postet. Das Gewinnspiel endet am 1. Oktober 2025, und der Gewinner wird zufällig ausgewählt. Was das eigentliche Obiter Dictum angeht, freuen wir uns ganz besonders über eure Kommentare zu den Themen Streetfotografie und Recht auf die eigene Stimme und beantworten einige in dieser Folge. Zu den letzten Folgen passt auch ein Urteil, in dem es um heimliche Videoaufnahmen in einem WG-Zimmer geht. Wir erläutern, warum solche Aufnahmen nicht automatisch strafbar sind. Zum Abschluss beantworten wir eine „Private Frage an die Podcaster“, diesmal mit Fun und Fakten. Wenn ihr ebenfalls Fragen habt, zögert nicht, uns zu kontaktieren, sei es per Kommentar, Kontaktformular oder über soziale Netzwerke. Ferner spielen wir das Rechtsbelehrungs-Bingo, bei dem wir uns herzlichst bei w4tsn ~> bedanken. Wir hoffen, Ihr habt mit der Episode genauso viel Freude, wie wir bei der Aufnahme und wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg beim Gewinnspiel! Zeitmarken 00:00:00 – Präfatio ad obiter Dictum mit Buchvorstellung und Gewinnspiel! 00:04:20 – Gewinnspiel mit Buchverlosung. 00:09:30 – Kommentare zum Recht an der eigenen Stimme: Kann man die eigene Stimme verkaufen? 00:16:30 – KI-Kritik, Technikfeindlichkeit und Zukunftsnaivität 00:20:40 – Kommentare zur Streetfotografie: Wie kann man negative, z.B. sexuell motivierte Fotos als solche erkennen? 00:28:00 – Fotografien von Kindern im öffentlichen Raum und Aufnahmen in Kriegs- und Krisengebieten. 00:35:00 – Das Rechtsbelehrungs-Bingo. 00:43:00 – Heimliche Kamera im WG-Zimmer ist nicht immer strafbar? 00:51:30 – Die private Frage an die Podcaster. 01:01:00 – Hinweise auf die Geltung des Data Act ab September. Weiterführende Links Darf ich Privatpersonen zu Beweiszwecken filmen? – Rechtsbelehrung 126. Das Recht an der eigenen Stimme – Rechtsbelehrung 138. Streetfotografie vs.Creeptografie – Rechtsbelehrung 137. Oberlandesgericht Hamm, AZ. 4 ORs 24/25 – Urteil zu heimlichen Aufnahmen im WG-Zimmer. Der Beitrag Bingo, Fun-Facts und heimliche Kameraufnahmen – Obiter Dictum 16 erschien zuerst auf Rechtsbelehrung.

Das Recht an der eigenen Stimme – Rechtsbelehrung 138
In der Vergangenheit haben wir schon oft über das „Recht am eigenen Bild“ diskutiert. Auch das „Recht am eigenen Wort“ war bereits Thema in der Rechtsbelehrung. Heute freuen wir uns daher ganz besonders, ein Persönlichkeitsrecht zu beleuchten, das bisher eher im Schatten stand: das „Recht an der eigenen Stimme“. Dieses Recht hatte jenseits des Schutzes von ausübenden Künstlern und von Parodien eine eher geringe eigenständige Relevanz. Doch mit dem Aufkommen von KI-Anwendungen, die Stimmen täuschend echt nachahmen können, erlebt das Recht an der eigenen Stimme eine regelrechte Renaissance. In dieser Episode sprechen wir daher mit unserem Gast, und als Opern- und Konzertbariton, Stimmexperten auf technischer und juristischer Ebene, Christoph Engel-Bunsas (Maîtrise en Droit, LL.M., MBA). Wir erfahren, was eine Stimme überhaupt ausmacht, wie sie rechtlich geschützt wird und ob das Kopieren von Stimmen mittels KI zulässig ist. Christoph Engel-Bunsas ist ein vielseitiger Experte an der Schnittstelle von Recht und Kunst. Mit seinem akademischen Hintergrund (Maîtrise en Droit, LL.M., MBA) und als Autor der Werke „Das Recht an der eigenen Stimme“ sowie „Recht an der Stimme in Zeiten von Deepfakes“ (Recht Digital 6/2025, paid) hat er sich als Spezialist für Stimmrechte im digitalen Zeitalter etabliert. Ein weiterer Fachbeitrag zu diesem Thema erscheint demnächst in der GRUR-Prax. Nach seinem Rechtsstudium in Deutschland und Frankreich steht er kurz vor der Zulassung als französischer Rechtsanwalt (Avocat) im Herbst 2025, gefolgt von Eignungsprüfungen in Deutschland und der Schweiz. Neben seiner juristischen Karriere ist Engel-Bunsas ausgebildeter und praktizierender Opern- und Konzertbariton und teilt seine Expertise und Leidenschaft im Podcast „Let’s Talk Why„, den er gemeinsam mit dem Pianisten Alessandro Limentani moderiert. Wir bedanken uns herzlich bei Christoph Engel-Bunsas für seinen Besuch und seine erhellenden Erläuterungen sowie dafür, dass er unsere zahlreichen Fragen beantwortet hat. Es war uns eine große Freude, und wir wünschen euch viel Vergnügen beim Hören! Zeitmarken 00:00:00 – Vorstellung des Gastes Christoph Engel-Bunsas und des Themas. 00:04:30 – Was ist eine Stimme technisch und rechtlich? 00:18:45 – Die Stimme als Teil der Persönlichkeit: allgemeine und besondere Persönlichkeitsrechte. 00:23:30 – Arten von Stimmimitationen und deren Zulässigkeit. 00:33:00 – Gibt es ein postmortales Stimmrecht nach dem Tod? 00:39:00 – Welche Rechtsverletzung wiegt schwerer: die des Bildes oder der Stimme? 00:47:00 – Wann liegt eine Verwechslungsgefahr bei Stimmen vor? 00:58:00 – Nutzung der eigenen Stimme für KI-Zwecke: Wie kann man gegen die Verletzung des Rechts an der eigenen Stimme rechtlich vorgehen? 01:08:00 – Einwilligung, Vertrag und AGB: Wie kann die Nutzung einer fremden Stimme vereinbart werden und darf man KI für sich sprechen lassen? 01:19:30 – Wie sieht der Stimmrechtsschutz in anderen Ländern aus? Erwähnte Urteile und weiterführende Links Christoph Engel-Bunsa: Das Recht an der eigenen Stimme, Tectum, 2025. Schierholz, Anke: Der Schutz der menschlichen Stimme gegen Übernahme und Nach ahmung, Baden-Baden 1998. Schilcher. „Scarlett Johansson «schockiert»: Open AI nimmt KI-Stimme offline“, SRF.CH. „Dänemark will Persönlichkeitsrechte gegen Deepfakes stärken“, heise online. „Schauspielverband und Netflix legen Regeln für KI-Nutzung fest“, FAZ. BGH Urteil vom 8.6.1989 – I ZR 135/87 – Emil Nolde. OLG Hamburg, 08.05.1989 – 3 W 45/89 – Heinz Erhardt. Der Beitrag Das Recht an der eigenen Stimme – Rechtsbelehrung 138 erschien zuerst auf Rechtsbelehrung.

Streetfotografie vs.Creeptografie – Rechtsbelehrung 137
Anlässlich einer Meldung, dass die österreichische Datenschutzbehörde Straßenfotografie anscheinend nur mit Einwilligung erlauben soll, sprechen wir über die Fallstricke der Bildaufnahmen von Menschen im öffentlichen Raum. Zu dem besprochenen Themen gehören: Welche Gesetze müssen wann beachtet werden? Müssen auch private oder nur professionelle Streetfotografen die DSGVO beachten? Wann ist die Aufnahme fremder Menschen erlaubt? Wann sind Aufnahmen von Personen verboten oder sogar strafbar? Dazu freuen wir uns sehr, erneut Dr. Nina Herbort als Expertin zu Gast begrüßen zu dürfen. Dr. Nina Elisabeth Herbort ist Rechtsanwältin und Gründerin der Berliner Kanzlei short.law, die sich auf Datenschutz für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Ihre Fachkenntnisse erstrecken sich über technische Aspekte des Datenschutzes, digitale Dienste und Auditierung. Sie ist ferner Gastdozentin an der Ostkreuzschule für Fotografie tätig. Mit etwa sieben Jahren Erfahrung als Referentin bei Datenschutz-Aufsichtsbehörden, darunter die Berliner Beauftragte für Datenschutz, und einem EDSA-Secondment in den Niederlanden, bringt sie umfassende Expertise in ihre Tätigkeit ein. (LinkedIn und Instagram). Wir danken Dr. Nina Herbort erneut für ihren Besuch, das spannende Gespräch und den Durchblick in ein aus Sicht von Fotografen zugleich wichtiges und kompliziertes Thema. Euch wünschen wir viel Vergnügen beim Zuhören und gebt Acht beim Fotografieren! P.S. wir freuen uns über postive Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Danke! Zeitmarken 00:00:00 – Vorstellung des Themas und unserer Gästin. 00:06:00 – Darf man Menschen auf der Straße fotografieren? 00:11:00 – Erkennbarkeit und welches Recht wird relevant, wenn Menschen fotografiert werden? 00:13:00 – Von Bismarck bis zur DSGVO – die Geschichte des Rechts am eigenen Bild. 00:18:30 – Gilt die DSGVO auch für Bildaufnahmen von Privatpersonen? 00:34:00 – Creeptografie und wann Fotografien die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte verletzen. 00:50:00 – Abwägung der Interessen der Fotografen vs. Interessen der Fotografierten und muss man bereits beim Fotografieren eine Einwilligung einholen? 00:58:00 – BVerfG: Streetphotografie ist ok, aber nicht, wenn sie draußen ausgestellt wird. 01:06:30 – Wann ist die Veröffentlichung von Fotoaufnahmen erlaubt und wie holt man eine wirksame Einwilligung ein? 01:20:00 – Wann dürfen Bildaufnahmen ohne Einwilligung auf Grundlage eines berechtigten Interesses erstellt werden? Bilder aus dem Bereich der Zeitgeschichte, Menschen als bloßes Beiwerk, Versammlung und höheres Interesse der Kunst. 01:36:00 – Unser Fazit, was man bei Fotos im öffentlichen Raum beachten muss. Weiterführende Links und Urteile Hamburg, Tätigkeitsbericht Datenschutz 2024 („Der Spanner ist kein Künstler“) – https://datenschutz-hamburg.de/service-information/taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht-datenschutz-2024#V-6= Österreich, Löschanordnung gegen Straßenfotografie (derStandard-Artikel) – https://www.derstandard.at/story/3000000269388/datenschutz-das-ende-der-ikonischen-strassenfotografie Bundesverfassungsgericht, 15.12.1999, 1 BvR 653/96 – (kein offizieller Link, Aktenzeichen zur Recherche) AG Hamburg, Beschluss vom 03.07.2020 – 163 Gs 656/20 – (Datenschutzverstoß durch das gezielte Fotografieren von fremden Personen zu privaten Zwecken). Bundesverfassungsgericht, 08.02.2018, 1 BvR 2112/15 („Frau im Leopardenmantel“). Herzogin Catherine / Oben-ohne-Fotos (französisches Urteil). BVerfG, 23.06.2020 – 1 BvR 1716/17 („Ebola-Fall, erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen strafrechtliche Verurteilung wegen Weitergabe einer unverpixelten Bildaufnahme an eine Presseredaktion). Relevante oder erwähnte Folgen der Rechtsbelehrung TTDSG – Cookies unter Aufsicht – Rechtsbelehrung 102. Wann gilt die DSGVO für Privatpersonen? – Rechtsbelehrung Folge 82. Wann darf ich Polizeikräfte filmen?– Rechtsbelehrung 125. Darf ich Privatpersonen zu Beweiszwecken filmen? – Rechtsbelehrung 126. Wann hat die Polizei das Recht, mich zu filmen? – Rechtsbelehrung 128. Der Beitrag Streetfotografie vs.Creeptografie – Rechtsbelehrung 137 erschien zuerst auf Rechtsbelehrung.

Rechtsbelehrung 136 – Bußgelder gegen Apple und Meta: Wirkt der DMA?
In dieser Folge begrüßen wir zum vierten Mal Dr. Sebastian Louven, um über Tech-Giganten und deren Marktmacht zu zu sprechen. Beim letzten Mal diskutierten wir noch über den Digital Markets Act (DMA), ein neues Gesetz der EU, das die Macht großer Konzerne wie Google, Meta, Apple und Amazon regulieren soll. Mittlerweile hat der DMA praktische Anwendung gefunden, was dazu führte, dass gegen Apple und Meta Bußgelder in Höhe von zusammen 700 Millionen Euro verhängt wurden. Wir erläutern, warum diese Bußgelder verhängt wurden, diskutieren die Frage, ob ihre Höhe angemessen ist, und untersuchen, welche Vorteile sich für Verbraucher ergeben (ganz besonders diejenigen, die „Fortnite“ auf ihren iPhones spielen wollen ). Darüber hinaus diskutieren wir, ob der Digital Markets Act (DMA) eine Lösung für das aktuelle Problem bieten könnte, dass Meta Nutzerdaten ohne Einwilligung der Nutzer für KI-Zwecke verwenden will. Unser Gast: Dr. Sebastian Louven Dr. Sebastian Louven, Rechtsanwalt und Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht, ist Partner bei der Louven Rechtsanwälte PartGmbB, einer auf Kartellrecht und Telekommunikationsrecht spezialisierten Kanzlei. Er ist Autor verschiedener Fachkommentare und war bereits in den Episoden 53 und 87 unser Gast. Mehr zu und von Dr. Louven: Webseite (https://louven.legal/), bei LinkedIn oder bei Twitter). Wir bedanken uns herzlich bei Dr. Sebastian Louven für seinen lehrreichen und spannenden Einblick in den DMA und wünschen Euch viel Vergnügen beim Zuhören. Zeitmarken 00:00:00 – Vorstellung des Themas und unseres Gastes Dr. Sebastian Louven. 00:05:00 – Erläuterung des Digital Markets Act (DMA) und der Rolle eines „Gatekeepers“. 00:17:00 – Diskussion über die Hintergründe des Bußgeldes gegen Apple. 00:39:00 – Gespräch über Bestreitbarkeit und die „Gummibandphysik“. 00:50:00 – Analyse des Bußgeldes gegen Facebook aufgrund unerlaubter Datenzusammenführung. 01:03:00 – Erörterung, ob die Nutzung von Nutzerdaten für das KI-Training gegen den DMA verstößt und ob dagegen rechtlich vorgegangen werden kann. Weiterführende Links Nach den ersten DMA-Bußgeldern: Wie kann es mit Private Enforcement weiter gehen? bei loven.legal. Kartellrecht, Marktmacht und Facebook – Rechtsbelehrung Folge 53. Virtual Reality, Facebook, WhatsApp und Macht der Plattformen – Rechtsbelehrung Folge 87. Digital Markets Act: Zähmung der Tech-Giganten – Rechtsbelehrung 117. Der Beitrag Rechtsbelehrung 136 – Bußgelder gegen Apple und Meta: Wirkt der DMA? erschien zuerst auf Rechtsbelehrung.
You may also like
Create Your Podcast In Minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast